Wolf-Dieter Batz am 28.6.1984:Peptide
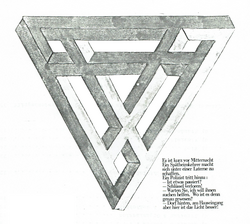
|
Wolf-Dieter Batz: „Zur Modellbildung in der Gedächtnisforschung“ |
- Peptide
Eine Idee, die bereits auf eine lange Tradition verweisen kann, nimmt die oben benutzte Schrift-Metapher als Basis.
Meine Metapher wird dabei zur Realität erklärt, indem kleine informationstragende Einheiten im ZNS postuliert werden, die sich analog den Worten einer Schriftsprache begreifen lassen. Es muß dann weiter eine Menge von 'Buchstaben' existieren aus denen die 'Worte' komponiert sind. Die Geschichte dieser Idee reicht zurück bis ins Jahr 1735. Damals vertrat ein gewisser SWIFT die Ansicht, daß der Mensch ihm unbekannte Sätze lernen könne indem er ein Stück Papier esse, auf dem eben diese Sätze mit einer sogenannten 'Gehirntinte' notiert seien. Bedingung dafür war lediglich, daß der Betreffende einige Zeit vorher und nachher nichts zu sich nehmen dürfe.
Ihren Popularitäts-Höhepunkt erreichte sie anfangs der siebziger Jahre dieses Jahrhunderts, was durch eine Unzahl diesbezüglicher Arbeiten belegt ist.[1] Dieser Erfolg führte dazu, daß verschiedene Gedächtnis-Psychologen bereits ihre und ihrer Kollegen Felle davonschwimmen sahen:
"Once man achieves the control over erasure and transmission of memory by means of biological and chemical methods, psychologists armed with memory drums, F tables and even on-line computers will have become superfluous in the same sense as philosophers became superfluous with the advancement of modern science: they will be permitted to talk - about memory, if they wish - but nobody will take them seriously."[2]
Wie es soweit kommen konnte, will ich jetzt anhand einiger Stationen versuchen nachzuzeichnen:
Auf der Suche nach dem Engram, die ein gewisser K.S. LASHLEY#[3] im Jahre 1950 begonnen hatte, führte James McCONNEL 1959 seine Experimente mit Planarien (Plattwürmer) durch.
Er trainierte diese Tiere mittels Elektroschock darauf, sich schnellstens von einer Lichtquelle zu entfernen. Als sie bei 90 Prozent der Versuche die gewünschte Reaktion zeigten, wurden sie halbiert um zu erfahren, wo denn nun das Engram in Zukunft zu suchen sei. Wie üblich regenerierten sich sowohl Kopf- als auch Schwanzhälfte wieder zu einem ganzen Wurm.
Als Ergebnis zeigte sich, daß beide Teile noch immer sehr lichtscheu waren. Das veranlaßte McCONNEL zu der Annahme, die Information sei im ganzen Körper, in jeder einzelnen Zelle, gespeichert. Dadurch tauchte die (alte) Frage nach dem 'Wie' auf. Wenn die Hypothese zuträfe, daß es sich um eine Speicherung innnerhalb der Zellen handelt, dann ist die Annahme einer chemischen Trägersubstanz sehr naheliegend.
Um dies zu klären, nutzte McCONNEL eine Verhaltensweise der Würmer: Kannibalismus! Wieder wurden Planarien auf Lichtaversion trainiert, nach erreichen des Lernkriteriums in kleine Portionen zerhackt und naiven Planarien als Futter vorgesetzt. Die Ergebnisse zeigten wieder einen Effekt, der sich im Sinne der formulierten Hypothese deuten ließ:
Die mit trainierten Artgenossen gefütterten Würmer waren schneller im Dunkel, als die mit untrainierten Artgenossen gefütterten.
Nachdem er mehrere Jahre mit Plattwürmern gearbeitet hatte, versuchte McCONNEL 1966 seine Ergebnisse an Wirbeltieren zu verifizieren:
Aus dem Gehirn trainierter Ratten extrahierte er die RNA-haltige Phase und injizierte sie direkt ins Gehirn von naiven Ratten. Die Ergebnisse zeigten wieder einen Effekt, der sich als Informations-Transfer deuten ließ.
Jetzt war es an der Zeit, nach der (den) Substanz(en) zu suchen, die als Träger der Information fungierte(n). Dieser Aufgabe nahm sich Georges UNGAR mit einigem Erfolg an.
Auch er trainierte wieder Ratten: Sie sollten, entgegen ihrem natürlichen Verhaltensmuster, den dunklen Bereich ihres Käfigs meiden. Waren die Ratten mithilfe der obligatorischen Elektroschocks vom Sinn dieses Verhaltens überzeugt, wurde wieder die stickstoffhaltige Phase ihrer Gehirne extrahiert. Dieses Mal jedoch nicht um sie naiven Ratten zu injizieren, sondern um sie qualitativ zu analysieren. UNGAR fand dabei eine Substanz, die ihm neu zu sein schien und nannte sie ihrer Wirkung gemäß 'Scotophobin'. Es handelte sich um eine Kette von 15 Aminosäuren, ein sogenanntes Pentadekapeptid folgender Struktur:[4]
Ser-Asp-Asn-Asn-Gln-Gln-Gly-Lys-Ser-Ala-Gln-Gln-Gly-Gly-Tyr-NH2
Nach Entschlüsseln dieser Struktur konnte die Substanz synthetisiert und wiederum auf ihre spezifischen Wirkungen untersucht werden. Genau wie bei Injektion der natürlichen Substanz zeigten die behandelten Ratten eine auffällige Scheu vor der Dunkelheit.
Inzwischen hatte sich um den 'chemischen Gedächtnistransfer' ein regelrechter Boom entwickelt, der eine große Zahl von Wissenschaftlern beschäftigte. Immer wieder gab es neue Substanzen, die für ganz spezielle Verhaltensweisen verantwortlich waren: 'Anelatim' beim Ertönen einer elektrischen Klingel; 'Chromodiopsin' für die Farbunterscheidung etc etc.# Andererseits gab es Berichte,[5] daß 'Ratten-Scotophobin' auch in Goldfischen Dunkelangst erzeuge. Das führte zum Schluß eines universellen Codes der für ganze Arten oder Familien von Tieren gelten könne.
Möglicherweise weil dieser Ansatz so verlockend plausibel erscheint, ist eine kritische Auseinandersetzung mit ihm lange Zeit vernachlässigt worden. Es kann jedenfalls kaum an Gelegenheiten dazu gemangelt haben, denn die möglichen Stoßrichtungen sind ungemein vielfältig:
- Ein Plausibilitäts-Einwand könnte sich gegen den (implizit) elementaristischen Standpunkt richten: Wie ist z.B. die zeitliche oder räumliche Interpolation zwischen diskret festgehaltenen Erinnerungen denkbar?
- Ein informationstheoretisches Argument das auf die Endlichkeit der möglichen Kombinationen einer endlichen Menge von Aminosäuren hinwiese, würde ins Leere laufen, da die Anzahl dieser Kombinationen trotz ihrer Endlichkeit für die im Laufe eines Lebens zu speichernde Menge an Information noch ausreichend wäre. Mit der beschränkten Kapazität des ZNS zusammen betrachtet sieht es schon etwas anders aus: Wäre jede Tatsache in einem Peptid durchschnittlicher Länge codiert, dann würde die 'Masse' der über das Lebensalter hinweg gesammelten Information das Gehirn sprengen, auch dann wenn jedes Peptid nur einmal vorhanden wäre.
- für einen Monisten schließlich kann der Ansatz in dieser Form nicht akzeptabel sein. Wenn unklar bleibt, wie die aus Aminosäuren gebildeten 'Worte' gelesen werden, wird implizit eine Prämisse benutzt, die einen 'Homunculus' als letzendlich steuernde Instanz postulieren muß.
Einwände dieser Art lassen sich leicht mit dem Argument Voreiligkeit beiseite schieben: Es mangelt %n%o%c%h% an geeigneten Erkenntnissen, um derartige Ungereimtheiten aufzuklären. Abgesehen davon, daß dieses Argument in einer recht fragwürdigen Delegation des Problems an zukünftige Forschergenerationen besteht, ist die zuvor geäußerte Kritik auch an sich wenig effektiv, da sie auf die Interpretationen statt auf die Ergebnisse abzielt; diese aber sind Realität, und deshalb nicht mit Argumenten aufzulösen. Konkret existieren zwei weitere Möglichkeiten:
- Uminterpretation: Wenn die Ergebnisse als zuverlässig betrachtet werden können, dann könnte auch der Fall eingetreten sein, daß die Forscher auf eine falsche Frage eine richtige Antwort bekommen haben. Das bedeutet, daß bei veränderten Prämissen dieselben Ergebnisse zu anderen Aussagen führen können.
- methodische Fehler: schließlich sind der härteste Einwand der gemacht werden kann. Als Quellen von Artefakten kommen in der Hauptsache Versuchsleiter-Effekte oder unvollständige Versuchspläne in Frage.
Eine Kombination der beiden letzten Punkte bildet die Basis für Arbeiten, die sich kritisch mit dem in doppeltem Sinn 'molekularistischen' Ansatz der Gedächtnis-Peptide auseinandersetzten.
Allan L. JACOBSON und Jay M. SCHLECHTER[6] haben 1970 versucht, eine Zwischenbilanz dieses Programms zu ziehen. Ihre Betrachtung geht hauptsächlich auf inkonsistente Ergebnisse und Fragen des experimentellen Designs ein.
Die Inkonsistenz von Ergebnissen hat JACOBSON & SCHLECHTER zufolge den Grund, daß die relevanten Variablen einer Gedächtnistransfer-Prozedur noch nicht genügend bekannt sind. Akzeptiert man diese Ansicht, muß man allerdings mit beträchtlichen Schwierigkeiten rechnen: J & S berichten einen Fall, bei dem zwei routinierte Chemiker praktisch 'Seite an Seite' das gleiche Transfer-Experiment durchführten, und trotzdem zu völlig verschiedenen Ergebnissen gelangten. Daraus schließen sie auf die Existenz äußerst subtiler Variablen, die bis dahin völlig unbeachtet geblieben seien.
Die Nichtreproduzierbarkeit von Ergebnissen führt in der Regel auch dazu, daß das experimentelle Design auf seine Tauglichkeit überprüft wird. 'Design' kann hierzu o.B.d.A.[7] auf seinen graphischen Aspekt reduziert werden.
Derart veranschaulicht, könnten die oben referierten Experimente von McCONNEL und UNGAR etwa so ausgesehen haben:
*=========================*=======================* | | | | Experimentalgruppe | Kontrollgruppe | | | | +-------------------------+-----------------------+ | | | | Tiere denen Extrakt | unter normalen | | aus dem Gehirn von | Laborbedingungen | | trainierten[8] Tieren | gehaltene Tiere | | injiziert wurde | ohne Injektion | | | | *=========================*=======================*
Dies stellt bereits ein vollständiges experimentelles Design einer Untersuchung dar. Es erlaubt die Prüfung folgender Alternativ- bzw. Null-Hypothesen:
H1: Die Ergebnisse von Experimentalgruppe und Kontrollgruppe sind verschieden.
H0: Die Versuchsergebnisse der beiden Gruppen unterscheiden sich nicht.
Für den Fall, daß die an der Experimentalgruppe vorgenommene Manipulation vollständig beschrieben werden kann, ist ein solches Design völlig ausreichend - aber nur dann!
Für die Untersuchung von Transfereffekten scheint mir ein etwas komplexerer Versuchsplan adäquat zu sein:
*===============*===============*===============*===============* | | | | | | Ex-Gruppe 1 | Ex-Gruppe 2 | Ex-Gruppe 3 | Kontrolle | | | | | | +---------------+---------------+---------------+---------------+ | | | | | | Injektion mit | Injektion mit | Injektion mit | | | Extrakt von | Extrakt von | Extrakt von | keine | | trainierten | stimulierten[9] | normalen | Injektion | | Tieren | Tieren | Tieren | | | | | | | *===============*===============*===============*===============*
Mit diesem erweiterten Design können zwei zusätzliche Alternativ-Hypothesen geprüft werden deren Inhalt den folgenden Fragen entspräche:
H2: Ist die Substanz, die für den Transfer-Effekt verantwortlich ist, ein Produkt, das infolge der Stimulation während eines Konditionierungsprozesses gebildet wird?
H3: Oder ist diese Substanz in jedem Gehirn vorhanden, wobei eine kleine Veränderung ihrer Konzentration (durch einen Transfer-Versuch etwa) bereits zu markanten Verhaltensänderungen führt?
Ob Designs dieser Form angewendet wurden und zu welchen Ergebnissen sie führten, braucht im Rahmen dieser Arbeit nicht untersucht zu werden. Gleichwohl macht sich aber bei der Verfolgung der Forschungslinie des Scotophobins eine Wendung hin zur Suche nach alternativen Erklärungsmöglichkeiten bemerkbar[10]. So war die Ähnlichkeit von Scotophobin und dem funktionellen Teil des HVL-(Peptid-)Hormons ACTH[11] bezüglich ihrer physiologischen Wirkung, Anlaß für Untersuchungen, die von einer unspezifischen Erhöhung des Aktivationsniveaus als Ursache für eine gesteigerte Dunkelangst bei den Versuchstieren ausgingen. Einige Ergebnisse dieser Untersuchungen will ich zum Schluß kurz referieren.
Wie beim Scotophobin handelt es sich auch beim ACTH um ein Peptid. Insgesamt besteht das ACTH aus 39 Aminosäuren (AS) von denen die ersten 23 als funktionelle Gruppe wirksam sind. Die letzten 16 sind artspezifisch.
Die Wirkung des ACTH besteht in einer verstärkten Ausschüttung von Hormonen der Nebennierenrinde. Der Effekt dieser Hormone wird allgemein als 'Alarmreaktion' beschrieben, d.h. der Organismus wird u.a. auf ein höheres Aktivationsniveau befördert. Das wiederum hat ganz charakteristische Folgen für die intern ablaufenden Prozesse:
Ratten ohne HVL hatten beträchtliche Probleme beim Erlernen einer Vermeidungsreaktion. Eine Injektion von ACTH stellte ihre Lernfähigkeit wieder vollständig her.[12] Durch Versuche mit Kettenbruchstücken des ACTH läßt sich der Teil des Peptids identifizieren, der für diesen Effekt verantwortlich ist: Nach deWIEDs Ergebnissen reicht die Sequenz ACTH(4-7) aus, um denselben, das Vermeidungslernen erleichternden Effekt zu erzielen.[13]Allein diese Befunde sollten, unter der Prämisse der Replizierbarkeit, Anlaß genug sein, den Eindruck einer Informationsspeicherung im Scotophobin, bzw. in Peptiden allgemein, zu relativieren. Weitere Unterstützung erfährt dieses Argument durch ein Ergebnis von UNGAR & BURZYNSKI[14]. Diese hatten radioaktiv markiertes[15] Scotophobin durch den Körper verfolgt:
Die größten Ansammlungen fanden sich in der Hypophyse (!) und dem Rückenmark. Dabei bleibt die Frage offen, ob tatsächlich die ganze Molekül dort angekommen ist, oder ob bestimmte funktionelle Teilstücke bereits in anderen Peptiden (möglicherweise dem ACTH) 'eingebaut' waren.
Dieser Gedanke führt zu einer Metamorphose der anfänglichen Idee des Peptid-Ansatzes: Auf welcher Basis eigentlich darf angenommen werden, daß Peptide einen permanenten Speicher bilden könnten? Ist dies denn überhaupt noch plausibel, wenn man berücksichtigt, daß selbst Hormone ständig neu synthetisiert werden müssen, daß also permanente Auf- und Abbauprozesse im Gange sind, in die %a%u%c%h% (warum nicht?) die Gedächtnis-Peptide miteinbezogen wären?
In dieser Hinsicht folgerichtig ist die durch McCONELLs Plattwürmer entstandene Idee des frei im Organismus beweglichen Gedächtnisses im Laufe der Zeit mehr und mehr 'aus der Mode gekommen'. An ihre Stelle trat die Vorstellung des Scotophobins als eines 'Schalters' dem eine Rolle bei der Bahnung von synaptischen Verbindungen zufallen sollte. Dies gehört aber bereits zu einem weiteren Modell, das ich weiter unten darstellen werde.#[16]
Modellevaluation[17]
*==============*===============*================*===============* | | | | | | Phänomen | Trans- | hypothetischer | Quellen | | | formationen[18] | Mechanismus | | | | | | | +--------------+---------------+----------------+---------------+ | | | | | | | | | 1) öffentl. | | permanentes | Info.aufnahme | Situationen | Pressewesen | | (Langzeit-) | ===> | werden entspr. | 2) DNS = | | Gedächtnis | Peptid-Synth. | gew. Syntax als| Erbsubstanz | | >>Engramme<< | | Peptid notiert | 3) 'labeling' | | | | | (Immunologie) | | | | | | *==============*===============*================*===============*
Wie bereits erwähnt, ist meist nicht unmittelbar ersichtlich, was das Vorbild, die 'Quelle', eines Modells darstellt. Ich benütze darum stets die Annahme, es handle sich um einen Paramorphismus, solange sich irgendwelche plausiblen Quellen finden lassen.
Im Fall des Peptidmodells wird mehrfach auf die Immunologie als Quelle Bezug genommen. Tatsächlich spricht man auch von einem Gedächtnis des Immunsystems, weshalb diese Quelle als plausibel gelten mag.
Die Quelle für die Codierung stellt meiner Ansicht nach die Informationsrepräsentation mittels der DNS dar. Auch in diesem Fall bildet eine begrenzte Menge von Molekülen regelrechte Sätze, die mittlerweile sogar von Menschen gelesen werden können.
Der ursprünglichen Annahme frei im Organismus beweglicher Moleküle, diente wohl ein öffentliches Pressewesen als als Vorbild.
Trotz mehrerer Quellen ist der hypothetische Mechanismus, das Modell%(!), nur wenig explizit auffindbar. Er bleibt eher, nach traditioneller Manier, in einer 'black-box' verwahrt, welche Information aufnimmt und daraus Peptide produziert. Wegen der postulierten kausalen Transformation handelt es sich dennoch um ein Modell, wenngleich die Formulierung existentieller Hypothesen auf der Strecke blieb.
Diplomarbeit "Zur Modellbildung in der Gedächtnisforschung" bei Dr. A.Metraux, Prof. HJ Ahrens und Prof. M.Zimmermann
- ↑ vgl. Taylor,G.R.: The Biological Time Bomb. (1968)
- ↑ vgl.: Tulving,E. & Madigan,S.A.: Memory and Verbal Learning.
- ↑ vgl. Kap.2: 'Wie?'
- ↑ Legende: Ala=Alanin; Asn=Asparagin; Asp=Asparaginsäure; Gln=Glutamin; Gly=Glycin; Lys=Lysin; Ser=Serin; Tyr=Tyrosin
- ↑ eine chronologisch geordnete Liste dieser Substanzen findet sich bei G.Chapouthier (1973): 'Behavioral Studies on the Molecular Basis of Memory.' S.14
- ↑ Jacobson,A.L. & Schlechter,J.M.: 'Chemical Transfer of Training: Three Years Later.' in: Pribram,K.H.(1970): 'Biology of Memory' S.123-128.
- ↑ o.B.d.A. <=> ohne Bedenken des Autors
- ↑ 'trainiert' steht hier für irgendein gelerntes Verhalten das die Spendertiere über klassische oder operante Konditionierung erworben hatten. Das spezielle Verhalten sowie die Trainingsprozeduren variieren z.T. erheblich zwischen den einzelnen Autoren.
- ↑ 'stimuliert' bedeutet, daß die Tiere z.B. eine klassische Konditionierung durchmachten, ohne etwas zu lernen. Dies wird einfach dadurch erreicht, daß UCS und CS völlig zufällig kombiniert auftreten.
- ↑ vgl.: Zippel,H.-P.(1973): Memory and Transfer of Information.
- ↑ ACTH ist das AdrenoCorticoTrope Hormon (auch Corticotropin), welches vom Hypophysen-Vorderlappen (=%HVL) in den Blutkreislauf abgegeben wird. Auf diesem Wege erreicht es die Nebennierenrinde wo es deren Hormonsekretion stimuliert.
- ↑ vgl.: de Wied,D.: Peptides and Behavior. S.373f. in: Zippel (1973)
- ↑ vgl.: a.a.O.
- ↑ nach Flechtner,H.-J.(1973): Biologie des Lernens. S.234ff.
- ↑ die Markierung erfolgte mit dem Jod-Isotop ¦++J, welches sich in einer sogenannten Substitutions-Reaktion an den Positionenen der üblicherweise vorhandenen Wasserstoffatome anbringen läßt. Zu beachten ist dabei, daß eine solche Veräderung eines Moleküls auch das Reaktionsverhalten ändert. Es kann dadurch zu Artefakten kommen, die sich bei einer Markierung mit dem Wasserstoff-Isotop +H (Tritium) oder dem Isotop ¦+C des Kohlenstoffs (Radiokarbon) vermeiden ließen.
- ↑ vgl. 'synaptischer Widerstand' in diesem Kapitel.
- ↑ vgl. Kap.1: 'Modell & Theorie'
- ↑ um eine Unterscheidung von modalen und kausalen Transformationen zu gestatten, benutze ich die Symbole '===>' für kausale, und '<===>' für modale Transformationen.